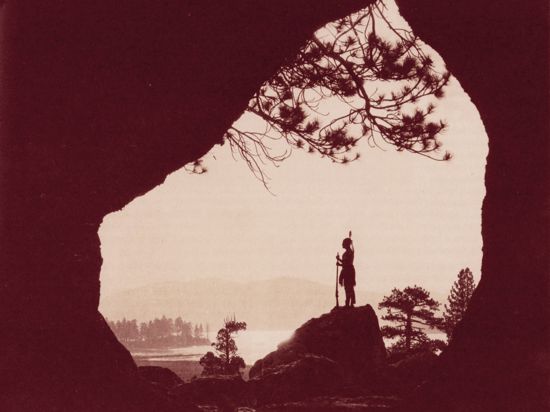Derart fulminant dürfte das Karlsruher Stummfilmfestival wohl noch nie eröffnet worden sein: Ein rund 50-köpfiges Orchester, eine wuchtige und vielschichtige Komposition, ein eindrucksvolles Revolutionsdrama und ein voll besetzter Stephansaal waren Zutaten für einen in jeder Hinsicht geglückten Abend, der mit anhaltendem Applaus belohnt wurde.
Der russische Film „Das neue Babylon“ war ein mehr als würdiger Auftaktfilm für die 20. Ausgabe des Festivals. Zum einen dank der virtuosen Bildgestaltung der Regisseure . Vor allem aber wegen der packenden Originalmusik von Dimitri Schostakowitsch.
Die erst vor einigen Jahren aus Archiven geborgene Komposition wurde vom KIT-Kammerorchester unter der Leitung von Francois Salignat hervorragend interpretiert.
Stummfilme sind wie ein Zeitspiegel.Albert Käuflein, Kulturbürgermeister Karlsruhe
Beides bestätigte einen Aspekt, den Karlsruhes Kulturbürgermeister Albert Käuflein in seinem Grußwort der Wiederbegegnung mit Stummfilmen zugesprochen hatte: „Diese Filme sind wie ein Zeitspiegel, man erfährt viel über das Lebensgefühl der Menschen der damaligen Zeit.“
Film wurde durch Stalins Zensur geprägt
Im Fall des „Neuen Babylon“ wird das sogar doppelt erkennbar. Denn die Zensur der Stalin-Ära zwang die Regisseure dazu, ihr Melodram um eine unglückliche Liebe zur Zeit der Pariser Kommune 1871 so zu kürzen, dass die politische Kritik an der „ausbeuterischen Bourgeoisie“ und deren militärische Gewalt den Film dominiert. Und die Musik von Schostakowitsch wurde nur in ganz wenigen Aufführungen gespielt, weil sich Orchester wie Publikum überfordert fühlten.
Umso eindrucksvoller gerät die Wiederentdeckung mit dieser reichen und erzählerisch hintersinnigen Klangwelt, die mit den Filmbildern in einen Dialog voll spannender Reibungskräfte tritt. Denn so präzise die Musik zum Rhythmus des Films gebaut ist, so konsequent geht sie über die seinerzeit übliche emotionale Untermalung hinaus. Oft eröffnet sie ergänzend und kommentierend eine zweite Erzählebene, mitunter in bitter-ironischem Kontrast zur Situation der Hauptfiguren.
Blutige Niederlage trifft schmissige Walzerklänge
So kündigen im Moment der blutigen Niederlage der Kommunarden die schmissigen Walzerklänge des ersten Aktes an, dass die vergnügungssüchtige Oberschicht triumphieren wird. Und das düstere Ende, wenn das getrennte Liebespaar des Films auf gegnerischen Seiten des Konflikts tödlich aufeinandertrifft, wird aufgebrochen durch einen offenen Schlussakkord, der signalisiert, dass der hier dargestellte Klassenkampf weitergehen wird.
Das Kammerorchester des KIT lässt diese komplexe Partitur melodisch, dynamisch und atmosphärisch aufblühen. Und es meistert die Herausforderung, 90 Minuten lang mit nur kurzem Atemholen zwischen den Filmakten durchzuspielen, auf höchstem Niveau.
Ein Auftakt, der Käufleins Lob untermauerte, das von dem Verein Deja-Vu organisierte Festival sei ein „Geschenk“ an die Stadt Karlsruhe. Festivalgründer und -leiter Josef Jünger griff diesen Ball gerne auf: Man mache dieses „Geschenk“ gerne noch so lange wie möglich – zumal je „unverzichtbarer“ die Veranstaltung, die ihr knappes Budget seit jeher mit hohem ehrenamtlichen Engagement ausgleicht, seitens der Stadt eingestuft werde.
Noch bis zum Sonntag dauert das reichhaltige Festival, das dann zum Ausklang ein Kinderprogramm mit Scherenschnittfilmen der deutschen Pionierin Lotte Reiniger bietet. Alle Aufführungen werden mit Live-Musik begleitet – wenn auch nicht mit einer derart großen Besetzung wie beim KIT-Kammerorchester, dessen Auftritt eigentlich schon vor drei Jahren geplant war und mit dem jetzt, wie Festivalleiter Jünger sagte, „ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen ist“.